Meldungen - LWF aktuell 152
Die Rubrik Meldungen enthält für Sie in aller Kürze wichtige Informationen zu Themen der Forstwirtschaft, des Naturschutzes, der Jagd und anderer relevanter Umweltbereiche in Bayern und Deutschland.
CO2-Senke der Zukunft
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Woche der Umwelt 2024: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Jörg Finkbeiner, Geschäftsführer von „Partner und Partner Architektur", in einem 1:1-Modell (© P. Himsel/DBU)
Architektonisch anspruchsvolles Hochhaus mit integrierter Zukunftskomponente – ein „Woodscraper" mit einem Tragwerk aus Massivholz entsteht seit Oktober 2024 in Wolfsburg. Alle verbauten Materialien und Komponenten aus nachwachsenden Rohstoffen sollen später in einen Stoffkreislauf eingebunden werden. Flexible Grundrisse schließen einen Abriss aus und speziell entwickelte Holzverbindungen ermöglichen eine zerstörungsfreie Demontage, sodass eine Wiederverwendung jederzeit möglich ist. Baubegleitend findet ein Forschungsprojekt (gesteuert durch das Büro Partner und Partner Architektur) statt, das durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert wird. Die Bedeutung von Holz in der Baubranche wächst. „Die Woodscraper setzen innovative Maßstäbe für nachhaltiges Bauen und Wohnen", sagt Architektin und Leiterin des DBU-Fachreferats Zukunftsfähiges Bauwesen, Sabine Djahanschah. Das Holzhochhaus trägt dank des klimapositiven Baustoffs zum Einsparen von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor bei. Die kreislauforientierte Wiederverwendung des verbauten Holzes belegt auch das Begleitprojekt. Bauherrin des Woodscrapers ist die sozial-ökologische GLS Bank. Entwickelt hat das Projekt die Unternehmensgruppe Krebs. Woodscraper stehen beispielhaft für eine nachhaltige und umweltschonende Bauindustrie. Ein Modell des Holzhochhauses wurde bei der „Woche der Umwelt 2024" präsentiert und war auch eine Station beim Rundgang des Bundespräsidenten.
Gerüstet für den Ernstfall im Bergwald?
Welche Waldschutzsituation uns im voranschreitenden Klimawandel im Bayerischen Alpenraum erwartet, was bei großflächigen Störereignissen zu beachten ist und welche Prioritäten bei der Aufarbeitung gesetzt werden sollten: Fragen, die im Fokus eines gemeinsam ausgerichteten Workshops der BaySF (Teilbereich Waldbau) und der LWF (Abt. Waldschutz) standen.
Was, wenn eine Borkenkäferkalamität wie in Osttirol und Kärnten bei uns auftreten würde? Ein realistisches Szenario. DI Benjamin Kössler (Waldschutz Tiroler Landesregierung) zeigte mit eindrucksvollen Bildern und Daten aus Osttirol, dass der Buchdrucker auch über 1.000 m ü. M. großflächige Kalamitäten verursachen kann. Die Ausbildung mehrerer Käfergenerationen und steigenden Befallsdruck in solchen Höhen bekräftigte auch Dr. Tobias Frühbrodt (LWF). Michael Hollersbacher (BaySF) betonte ebenfalls, dass solche Ereignisse auch im bayerischen Alpenraum auftreten können.
Humusschutz bei der Aufarbeitung von Kalamitätshölzern sichert Nährstoff- und Wasserversorgung im Bergwald. „Wenn ich dem Humus helfe, helfe ich dem Bergwald!“, so Prof. Axel Göttlein (TUM). Vorausverjüngung oder auch Vorwaldstrukturen beugen vor. Leiter des Nationalpark Berchtesgaden, Dr. Roland Baier, betonte die Bedeutung der Verjüngung und des lokalen Artenspektrums, um die Folgen von Störungsereignissen abzumildern.
Der Workshop machte deutlich, dass es viele vorbeugende Maßnahmen gibt, die im Ernstfall die Abläufe erleichtern. Das Fazit aller Beteiligten: Präventiv handeln wird sich auszahlen!
Tobias Frühbrodt und Andreas Hahn, LWF
Erneut zeckenreiches Jahr erwartet
Auch im Jahr 2025 rechnen Forschende mit vielen Zecken. Milde Wintermonate führen zu einer ganzjährigen Aktivität, die bereits in den letzten Jahren bei den Tieren beobachtet wurde, informiert Prof. Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim auf einer Pressekonferenz in Stuttgart. Bereits im Januar 2025 traten erste Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf. Nach dem Rekordjahr 2022 (718 Fälle) meldete das Robert-Koch-Institut für 2024 die zweithöchste Zahl (686 Fälle) an FSME-Fällen seit Meldebeginn. Betroffen sind auch Nicht-Risikogebiete. Ein Infektionsrisiko ist also flächendeckend für Deutschland vorhanden. Prof. Dr. Gerhard Dobler (Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr) rät dringend zur Impfung, um Langzeitfolgen nach schweren Infektionen vorzubeugen. Forschende beobachten mittlerweile jedes zweite Jahr, anstatt jedes dritte wie früher, hohe Erkrankungszahlen - Trend steigend. Fast 80 % der Fälle im Jahr 2024 wurden aus Süddeutschland gemeldet, allein 311 Fälle aus Bayern. Aktuelle Daten aus Tirol und Vorarlberg belegen ein deutlich gesteigertes Infektionsrisiko mit FSME bei Ungeimpften. Europäische Zecken übertragen die FSME-Erreger. In Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei 1:50 bis 1:100. Nach ca. zehn Tagen treten grippeähnliche Symptome auf. Schwere Verläufe können u. a. Lähmungen verursachen; für etwa ein Prozent der Erkrankten verläuft FSME tödlich.
Europäische Innovationskonferenz für den Forstsektor
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Podiumsdiskussion forstlicher Akteure der EU-Mitgliedstaaten
(© Bayerische Vertretung)
Vom 11.-12. Februar 2025 fand in Brüssel der „6th Forestry Innovation Workshop" statt. Gastgeber war die Bayerische Vertretung bei der EU. Die Veranstaltungsreihe wird federführend vom Liaison Office des Europäischen Forstinstituts (EFI) in Brüssel ausgerichtet. Mitorganisator in diesem Jahr war das aus EU-Mitteln finanzierte Partnerschaftsnetzwerk zur Förderung von Innovationen im Forstbereich „FOREST4EU" . Das gleichnamige Projekt wird an der LWF unter Bearbeitung von Dr. Kathrin Böhling durchgeführt. Während der zweitägigen Veranstaltung wurden neueste Innovationen erörtert, regionale Herausforderungen diskutiert und die Zusammenarbeit im gesamten forstwirtschaftlichen Sektor gestärkt.
Dr. Böhling hielt eine Keynote und initiierte eine Podiumsdiskussion für forstliche Akteure aus den Regionen der EU-Mitgliedstaaten. Maximilian Muninger, Bereichsleiter Forsten beim AELF Landau-Pfarrkirchen, vertrat Bayern in der Diskussion und betonte, dass es eine „echte Innovation" darstelle, wenn mehr Waldbesitzende ihren Wald aktiv bewirtschaften würden. Genau hier setzt das Projekt FOREST4EU an. Die Konferenz war mit über 150 Teilnehmenden, darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus innovativen Praxis- und Forschungsprojekten, ein großer Erfolg. Die Projektergebnisse werden in einer nachfolgenden Ausgabe der LWF aktuell vorgestellt.
Bayerische Niederschlagsstreifen
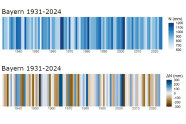 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Jährliche Niederschlagsstreifen für Bayern von 1931-2024.
(© LfU Klima-Zentrum 2025, basierend auf DWD Climate Data Center (CDC))
Das Klimazentrum des Bayerischen Landesamtes für Umwelt hat analog zu den bayerischen „Warming Stripes" Niederschlagsstreifen „Precipitation Stripes" erstellt. Die Streifen veranschaulichen visuell die Veränderungen des Niederschlags über einen bestimmten Zeitraum und beziehen sich dabei auf jährliche Niederschlagssummen oder Abweichungen vom langjährigen Mittel des Referenzzeitraumes 1971–2000. Auch für die Precipitation Stripes sind die Niederschlagsveränderungen in prägnanten Farbcodierungen darstellt.
Im Gegensatz zu den Warming Stripes lässt sich bei den Precipitation Stripes keine klare Entwicklung erkennen – die Niederschlagsstreifen zeigen sich deutlich variabler, was aber nicht bedeuten muss, dass der Klimawandel sich nicht im Niederschlag beobachten lässt. Veränderungen finden innerjährlich statt und eine leichte Umverteilung der Niederschlagsmengen zeichnet sich ab.
Wasser im Fokus
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
V.l.n.r.: Klaas Wellhausen, Lothar Zimmermann (LWF), Andreas Gorbauch (LfU Bayern), Thomas Corbeck (ALE Oberbayern) (© LWF)
Vom 19.–21. März versammelten sich Hydrologinnen und Hydrologen zum „Tag der Hydrologie 2025". Er findet alle zwei Jahre, dieses Mal in Augsburg, statt. Mittelpunkt der Tagung: Die Resilienz des Wasserhaushalts. Der Wasserrückhalt in der Landschaft wird immer wichtiger, da der Klimawandel vermehrt zu Extremereignissen wie Starkregen oder intensiven Dürreperioden führt. Wie lässt sich den Auswirkungen solcher Ereignisse vorbeugen? Eine Lösung besteht in der Anpassung und Optimierung der Landschaftsstruktur, die verschiedene Nutzungen umfasst – vom städtischen Bereich über die Landwirtschaft bis hin zum Wald. Dr. Klaas Wellhausen (LWF) präsentierte die
verwaltungsübergreifende Facharbeitsgruppe Landschaftswasserhaushalt, die gemeinsame Konzepte zur Steigerung des Wasserrückhalts erarbeitet. Beteiligt sind die Land- und Wasserwirtschaft sowie die ländliche Entwicklung. Vorgestellt wurde auch das neue Projekt „IQFluss Wald", das ebenfalls daran arbeitet, den Wasserrückhalt in der Waldfläche bei Starkregenereignissen zu verbessern. Dazu werden für verschiedene bayerische Naturräume Empfehlungen und Planungstools entwickelt.
Beitrag zum Ausdrucken
Weitere Informationen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
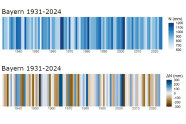 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden



