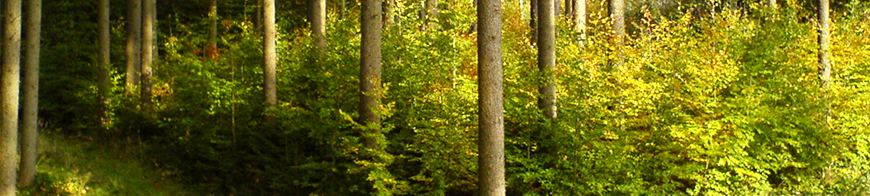LWF aktuell 150
Waldbauliche Überlegungen zum Speierling
von Paul Dimke
Der Speierling ist licht- und wärmebedürftig, langsam wachsend, konkurrenzschwach und anfällig gegen Wildverbiss. Es ist also nicht verwunderlich, dass diese Baumart keine Bestände bildet. Der Speierling könnte aber – bei entsprechender Förderung – ein weiterer Mischungsbaustein hin zu einem klimastabilen Wald sein und daher in den nächsten Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen.
Der Speierling (Sorbus domestica, synonym Cormus domestica) hat ein beachtliches Verbreitungsgebiet von Spanien über Mittel- und Südeuropa bis zum Schwarzen Meer. Dennoch ist er auch eine ausgesprochen seltene Baumart (Kausch-Blecken von Schmeling, 2000). Kausch-Blecken von Schmeling nennt für das Jahr 2000 eine Gesamtzahl von nur 6.000 älteren Speierlingen in Deutschland, davon etwa 2.500 in Bayern, schwerpunktmäßig im Weinbauklima Unterfrankens. Der Anteil des Speierlings an der Gesamtproduktion bayerischer Forstbaumschulen steigt auf sehr niedrigem Niveau seit einigen Jahren an und liegt unter 0,25 %. Die Verkaufszahlen liegen bei wenigen Zehntausend Stück pro Jahr (EZG, 2024). Das „Digitale Arboretum" der bayerischen Forstverwaltung, eine Zusammenstellung seltener heimischer sowie ursprünglich ausländischer Baumexoten, listet 256 „waldbaulich relevante Vorkommen" des Speierlings in Bayern auf (Wimmer, 2024). Bayerns vermutlich dickster Speierling steht in Hoftrieb/Halsbach in Unterfranken und wies bei der Messung 2013 einen Durchmesser von etwa 108 cm und eine Höhe von 18 Metern auf. Sein Alter wird auf etwa 140 Jahre geschätzt (Tim, 2024).
Abb. 1: Achtung Verwechslungsgefahr, zumindest beim Blick auf die Blätter. Die Borke hingegen ist bei der Vogelbeere immer glatt, mitunter sogar glänzend, beim Speierling rauh und rissig. Spätestens mit Fruchtbehang ist die Unterscheidung ein Kinderspiel: Oben Speierling, unten Vogelbeere. (© G. Aas)
Standortansprüche und Konkurrenzverhalten
Der Speierling bevorzugt warme, sonnige Lagen. Gegenüber Hitze und Trockenheit zeigt er sich außerordentlich robust. Am besten gedeiht er auf kalkhaltigen und nährstoffreichen Böden. Mit Flachgründigkeit, aber auch Tonböden, kommt er gut zurecht, sofern diese nie längere Zeit vernässt und sauerstoffarm sind. Nährstoffarme, saure Böden (tiefreichend < ca. ph 6), kühl-luftfeuchte Lagen sowie Beschattung durch Nachbarbäume bekommen ihm nicht. Die Nähe und moderate Beschattung von Eichen kann der beigemischte Speierling einige Jahre ertragen. Die un-mittelbare Nachbarschaft von Rotbuchen hingegen verträgt er nicht (Aas, 2024).
Nutzung im Wandel der Zeit: Holz, Früchte und Landschaftsbild
In früheren Jahrhunderten wurde der Speierling sowohl wegen seines Holzes als auch wegen seiner Früchte geschätzt. Es ist kein Zufall, dass große Speierlinge eher in Siedlungsnähe und in Streuobstwiesen als in geschlossenen Wäldern vorkommen (Aas, 2024). Das ausgesprochen feste und zähe Holz wurde für technisch anspruchsvolle Zwecke verwendet, z. B. für Holzzahnräder in Getreidemühlen (Grosser, 1988). Die Früchte sind roh essbar und wurden vor allem zur Herstellung von Apfelmost und Obstbränden verwendet, wobei sie aufgrund ihres hohen Gerbstoffgehalts oft erst nach Frosteinwirkung verarbeitet wurden. Landschaftsästhetisch ist der Speierling durch seine ausladende Krone, die auffälligen Früchte und seine Herbstfärbung ein wertvoller Bestandteil traditioneller Kulturlandschaften (Aas, 2024).
Zukünftige Bedeutung im Klimawandel
Aufgrund seiner Toleranz gegenüber Hitze und Trockenheit sollte der Speierling in Zukunft eine bedeutendere Rolle in der Waldbewirtschaftung spielen. Während viele heimische Baumarten zunehmend an ihre klimatische Toleranzgrenze geraten, kann der Speierling auf basischen, nährstoffreichen Standorten deren Position teilweise übernehmen. Als Mischbaumart kann er Waldbestände ökologisch, ökonomisch und ästhetisch bereichern und gegenüber Hitze und Trockenheit stabilisieren.
Forstliche Maßnahmen zur Förderung des Speierlings
Bedrängung und Kronenspannung durch Nachbarbäume sind bewährte waldbauliche Instrumente, um an Einzelbäumen („Z-Bäumen") konkurrenzstarker Baumarten in den ersten 20–30 Lebensjahren die natürliche Astreinigung durch seitliche Beschattung zu fördern. Dass der Baum dadurch nicht sein volles Vitalitätspotential entfalten kann, wird billigend in Kauf genommen, um astfreies Wertholz zu produzieren. Dem konkurrenzschwachen Speierling sollte man jedoch früher und stärker helfen, wenn eine bestmögliche Förderung und Vitalisierung angestrebt wird. Soll Wertholz produziert werden, lassen sich die Äste an den unteren Metern des Stammes auch mit Astungssägen entfernen, sodass in den folgenden Jahrzehnten astfreies Holz zuwachsen kann. Wer den Speierling wegen seiner Seltenheit oder seines ökologischen Wertes erhalten will, kann sich die Astung aber auch sparen.
Kultur und Dickungsstadium
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 2: Speierlinge können zu stattlichen Bäumen heran-wachsen wie hier in der Gemeinde Wirmsthal, Landkreis Bad Kissingen. (© K. Janitz AELF Würzburg)
Der Speierling ist in Forstbaumschulen erhältlich und mit circa 7 Euro für das Sortiment 30/50 cm bis 12 Euro für Ballenpflanzen (50/80 cm) etwa drei bis viermal so teuer wie gängigere Baumarten (Stand: Winter 2024/2025, Quelle: eigene Recherchen). Er ist lichtbedürftig und insbesondere fränkische Herkünfte gelten als immerhin mäßig spätfrosthart (Büchner, 2024/Ludwig, 2024). Geländemulden, in denen die Spätfrostgefahr besonders groß ist, sollten gemieden werden. Ansonsten sind Freiflächen ebenso geeignet wie Pflanzplätze unter lichtem Altbaumschirm. Bei vitalem, d.h. sehr kühl und feucht gelagertem und transportiertem Pflanzgut, und sorgfältiger Pflanzung erweist sich der Speierling in der Kulturphase als robust und wüchsig. An sonnigen und windigen Pflanzplätzen können die Blätter nach Regen schnell wieder abtrocknen. Dies schützt den Speierling vor schädlichen Blattpilzen (Schorf), insbesondere wenn er in den ersten Jahren gut ausgemäht wird (Ludwig, 2024). Bei überhöhtem Wildbestand ist Zaun oder Einzelschutz anzuraten. Kunststoffwuchshüllen sind für mindestens mittelgroße Pflanzsortimente erfolgversprechend, allerdings nur bei voller sommerlicher Sonneneinstrahlung, da die Wuchshüllen Licht abschirmen. Da das Pflanzgut teuer und besonders gewissenhafte Pflege somit ohnehin naheliegend ist, spricht nichts gegen weite Pflanzverbände. Je weiter und unschematischer der Pflanzverband ist, desto wichtiger ist es, die gepflanzten Bäume mit ausreichend hohen Stäben zu markieren, um sie im Sommer beim Ausmähen im hohen Kraut nicht zu übersehen oder versehentlich abzumähen. Speierlinge müssen in jedem Alter und qualitätsunabhängig kräftig gefördert werden. Nachbarbäume, die von oben her beschatten, sollten immer konsequent entnommen werden. Leichte seitliche Beschattung ist im Dickungsalter tolerierbar, wenngleich auch nicht vitalitätsförderlich.
Durchforstung
Speierlinge sollten stets vollständig frei stehen und nicht den Schatten durch Nachbarbäume ertragen müssen. Sollen die unteren 4–6 Meter des Stammes astfrei sein, so kann man bei jungen Speierlingen die unteren Äste absägen. So wächst in den folgenden Jahrzehnten wertvolles astfreies Holz hinzu. Duchforstungen sollten erfolgen, wenn Nachbarbäume die Speierlinge zu beschatten beginnen. Die bedrängenden Nachbarbäume werden bei der Durchforstung entnommen oder geringelt, sodass sie absterben.
Verjüngung und Arterhalt
Der Speierling ist dafür bekannt, selber nur wenig natürlichen Nachwuchs hervorzubringen. Die Gründe sind nicht abschließend geklärt. Folgende Bedingungen scheinen den Verjüngungserfolg zu verbessern: Volle Umlichtung durch Entnahme aller bedrängenden Nachbarbäume, sodass die Samenbildung angeregt wird, Auflichtung des Kronendaches für Halbschatten am Boden und Zäunung, sofern die Wildbestände noch nicht waldverträglich sind (Aas, 2024).
Zusammenfassung
Gegenüber zunehmender Hitze und Trockenheit scheint der Speierling gut gerüstet. Dies verschafft ihm Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Baumarten. Andererseits leidet er mehr als andere Baumarten unter direkter Lichtkonkurrenz durch beschattende Nachbarbäume. Zum Erhalt des Speierlings sind daher die konsequente und qualitätsunabhängige Förderung aller vorhandenen Individuen sowie die Neuanpflanzung im Wald und im Offenland dringend erforderlich.
Literatur
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Informationen
Autoren
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden