Forschungs- und Innovationsprojekt
Höhen- und Bewirtschaftungsgradient in einem deutschen Mittelgebirge zur Abschätzung von Veränderungen in Waldökosystemen im Klimawandel (Projekt C 39)

Veränderungen durch den Klimawandel lassen sich in der Natur derzeit am besten am Beispiel von Höhengradienten, die gleichzeitig einen Temperaturgradienten darstellen, abschätzen.
Daher wurde im Jahr 2009 in acht Naturwaldreservaten des Bayerischen Waldes im Rahmen eines bayerischen Verbundprojektes ein Höhengradient mit festen Probepunkten zur Untersuchung von Veränderungen im Klimawandel angelegt.
English version
Forest structure, occurrence and composition of various species groups (including plants, fungi and animals and genetic markers for some species) are being investigated in the Bavarian Forest region along an altitudinal gradient ranging from 300 to 1400 m above sea level and represent an inverse temperature gradient of 2.9 to 8.1°C on average. Samples are collected from plots within strict forest reserves that have not been managed for over 40 years, as well as from currently managed forests.
The aim of this research is to monitor and study the effects of climate change on species diversity in mixed forests composed of beech and oak, mixed mountain forests with fir, spruce and beech, as well as high mountain spruce forests. In addition, existing models for carbon sequestration in forests can be supplemented or validated. This altitudinal gradient offers the possibility to investigate the effect of climate change and management on a broad range of species groups and their composition.
Finally, recommendations for forest management, with regard to climate change and the consequences for biodiversity in forests, can be derived and suggested to forestry practitioners.
The work is divided into four modules:
Module 1: Forest structure
Forest structure will be assessed in circular study plots located in eight strict forest reserves.
Additionally, each of these plots will be paired with plots located in neighboring study sites within managed forests that are comparable in terms of elevation and growth conditions.
Module 2: Biodiversity
Species from seven species groups (vascular plants, lichens, fungi, birds, snails, caterpillars and wood-inhabiting beetles) will be sampled. For further analyses, species composition data will then be intersected with ecological parameters of the sampling sites.
Module 3: Genetic detection of mycorrhiza fungi
Mycorrhiza fungal species will be detected on the basis of genotypic characterizations and Amplicon sequencing. For further analyses, species community data will then be intersected with the parameters of the sampling sites.
Module 4: Within species genotyping
The main tree species (beech, fir and spruce), as well as a common mycorrhiza fungal species (Russula ochroleuca), will be analyzed to understand genetic differentiation within species along the altitudinal gradient.
Publications
Hintergrund
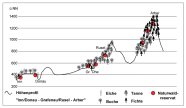 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 1: Schnitt durch den Bayerischen Wald (Grafik: LWF)
Der große Vorteil des Projektes liegt dabei in einem breit aufgefächerten Monitoring verschiedener Artengruppen auf identischen Flächen und der Einbeziehung von relevanten Standortparametern, wie es über diese Höhenausdehnung bzw. Temperaturbreite für Mitteleuropa bisher nicht existiert (Fischer et al. 2011). Der Schwerpunkt der bisherigen Forschung entlang von Höhengradienten hatte lediglich einzelne bzw. wenige Artengruppen im Fokus.
Der gewählte Höhengradient entlang der Naturwaldreservate des Bayerischen Waldes hat sich insbesondere aufgrund der relativ ausgeglichenen geologischen und damit auch seiner bodenkundlich verhältnismäßig homogenen Ausgangssituation bewährt. Die Höhenausdehnung reicht von den Lagen an Donau und Inn in ca. 300 m ü. NN bis in die höchsten Lagen des Bayerischen Waldes am Großen Arber (ca. 1.400 m ü. NN) bei über 1.000 m Höhendifferenz (Temperaturbereich von 2,9 °C bis 8,1 °C Jahresdurchschnittstemperatur) und relativ geringer geographischer Distanz (Abb. 1).
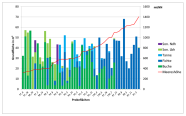 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 2: Baumartenzusammensetzungen (nach Blaschke et al. 2011)
Zielsetzung
Die Wiederholung von Aufnahmen in den Naturwaldreservaten macht es zudem möglich zu prüfen, ob sich bereits in einem Zeitrahmen von wenigen Jahren Veränderungen durch die lokale Klimaerwärmung in den vergangenen Jahren abzeichnen. Die seinerzeit aus dem Höhengradienten abgeleiteten Prognosen können somit überprüft werden. Darüber hinaus lassen sich auch vorsichtige Prognosen für die weitere Entwicklung dieser Wälder erstellen.
Aus den Ergebnissen können Empfehlungen für Waldbesitzer zur Waldbewirtschaftung in Hinblick auf die Entwicklung der Biodiversität bei anhaltendem Klimawandel verbessert und konkretisiert werden.
Für die Modellierung von Kohlenstoffmodellen im Wald können aus den Erhebungen wichtige Parameter zur lebenden oberirdischen Biomasse sowie zum Totholz in bewirtschafteten als auch seit Jahrzehnten unbewirtschafteten Wäldern bereitgestellt werden.
Für Veränderungen der Biodiversität in Waldbeständen innerhalb des untersuchten Raumes, können im Hinblick auf drei Ebenen Aussagen getroffen werden.
- Genetische Veränderungen einzelner Arten
- Veränderungen auf Artniveau
- Veränderungen auf Bestandes- bzw. Ökosystemebene
Dies soll insbesondere im Hinblick auf die Faktoren Klimaeinfluss als auch auf den Bewirtschaftungseinfluss untersucht werden.
Veröffentlichungen
Projektdaten
Projektleitung: Markus Blaschke
Projektbearbeiter: Angela Siemonsmeier
Kooperationspartner: Universität Bayreuth, Abteilung Mykologie; Technische Universität München, Lehrstuhl für Zoologie, Arbeitgruppe Molekulare Zoologie; Bayerische Staatsforsten AöR, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Laufzeit: 01.01.2018 – 30.05.2020
Finanzierung: Waldklimafonds
Förderkennzeichen: 22WC412201





