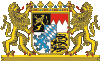RSS-Feed der Bay. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft abonnieren
So verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr. Unser RSS-Feed "Nachrichten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft" informiert Sie kostenlos über unsere aktuellen Beiträge.
Olaf Schmidt
Bayerns grüne Krone - Der Frankenwald wird Waldgebiet des Jahres 2017 - LWF aktuell 112
Unter dem Slogan »Frankenwald verbindet …« rief im November 2016 der Bund Deutscher Forstleute den Frankenwald zum Waldgebiet des Jahres 2017 aus. Nach dem Berliner Grunewald 2015 und dem Küstenwald Usedom 2016 ist nun der Frankenwald das Waldgebiet des Jahres. Grund genug für uns, sich den Frankenwald genauer anzuschauen, der wie kaum ein anderes Waldgebiet auf eine äußerst bewegte Waldgeschichte zurückblicken kann.
Der Waldanteil in Oberfranken liegt mit 40 % (ca. 285.000 Hektar) deutlich über dem bayerischen Durchschnitt von 35 %. Der Landkreis Kronach, der große Teile des Frankenwaldes umfasst, gehört mit einem Waldanteil von 60 % zu den drei am stärksten bewaldeten Landkreisen Bayerns. Manche Gemeinden des Frankenwaldes sind sogar bis zu 80 % bewaldet.Schon seit Jahrhunderten wird der Frankenwald durch Wald und die damit verbundene Forst- und Holzwirtschaft geprägt. Sein Wald- und Holzreichtum wurde bereits schon vor Jahrhunderten genutzt, zum Beispiel durch Flößerei, Köhlerei, Pechsieden und Pottaschegewinnung. Dies führte auch durch örtliche Übernutzungen zu einer deutlichen Veränderung der Baumartenzusammensetzung der Wälder.
Arme Böden, raues Klima
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb.1: Der Frankenwald ist ein deutsches Mittelgebirge im Norden Bayerns und Südosten Thüringens. (Foto: C Kelle-Dingel)
Die durchschnittliche Höhenlage beträgt zwischen 500 und 600 m ü.NN. Die höchsten Erhebungen des Frankenwaldes erreichen mit dem Döbraberg 795 m und dem Wetzstein 792 m. Das Klima zeigt sich als ein raues Mittelgebirgsklima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 6 °C, mit 140 bis 160 Frosttagen im Jahr und einem durchschnittlichen Niederschlag von 975 mm. Kennzeichnend sind auch der sehr späte Frühlingsbeginn im Frankenwald und die häufigen sehr kalten Ostwinde im Winterhalbjahr.
Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft betreibt im Frankenwald in der Nähe des Rennsteiges zwischen Steinbach am Wald und Tettau die Waldklimastation Rothenkirchen in einer Höhenlage von 650 m.
Einst Buchenwald und Eibenland
Der Waldmeister-Buchenwald und der Hainsimsen-Tannenbuchenwald würden sich kleinräumig im Frankenwald abwechseln (Türk 1993 a, b). Von den Baumarten sind hier die wichtigsten Begleiter der Buche die Weißtanne, in tieferen Lagen vor allem entlang der größeren Täler die Traubeneiche und auch die Eibe. Die Eibe wurde im Mittelalter vor allem wegen des regen Eibenholzhandels über Nürnberg sehr stark zurück gedrängt. Später rotteten die Fuhrleute die Eibe entlang der Straßen und Wege aus, da die Eibe für die Pferde enorm giftig ist.
Auch zu Zeiten der Waldweide haben die Bauern die Eibe wegen ihrer Giftigkeit für Rinder und Ziegen bekämpft. Die Kahlschlagverfahren der Forstwirtschaft seit dem 19. Jahrhundert und der steigende Rehwildverbiss haben weiter zu einem Rückgang der Eibe im Frankenwald geführt, so dass heute nur noch einzelne Exemplare in den Wäldern zu finden sind. Immerhin ist der älteste Baum des Frankenwaldes eine Eibe bei Schwarzenbach am Wald.
Steile Hänge und tiefe Täler
Heute noch kann man diese durch die Häufigkeit von Berg- und Spitzahorn in den dortigen Steilhangwäldern und durch das Auftreten von typischen Schluchtwaldbegleitern wie zum Beispiel Sommerlinde, Bergulme, Waldgeißbart, Mondviole, Christophskraut und Stacheligem Schildfarn erkennen. An den vielen kleineren und größeren Bachläufen wären Erlen- und Eschenwälder mit Traubenkirschen die natürliche Vegetation (Walter 1984).
Holzhandel und Flößerei
Dies führte bereits in der Zeit von 1500 bis 1800 zu einem starken Zurückdrängen der Buche und zu einer Förderung der Tanne. Die erste urkundliche Überlieferung der Flößerei stammt aus dem Jahr 1383 (Müller 1984). So verließen im Jahre 1821 10.700 sogenannte »Böden« (ca. 15.000 Festmeter) den Frankenwald, im Jahr 1870 bereits 40.000 Böden (ca. 200.000 Festmeter) (Moewes 2000).
Holzkohle für die örtlichen Hammerwerke
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb.2: Kohlenmeiler mit 100 Ster Holz waren keine Seltenheit. Bis zu vier Wochen schwelten große Kohlenmeiler vor sich hin. (Foto: S. Kuhn, Staatsarchiv Aargau)
Größere Kohlenmeiler enthielten 100 bis 120 Raummeter Holz. Für die Schmelze der Erze und die Bearbeitung von Metallen waren höhere Temperaturen nötig, die man mit der Hitze aus Holz allein nicht erreichen konnte. Daher benötigte man in großen Mengen Holzkohle. Je nach Meilergröße schwelte das Holz zwei bis vier Wochen, bis es zur Holzkohle wurde.
Für den Wald, aber insbesondere für die Laubbäume besonders belastend war die Pottaschegewinnung für die örtlich ansässigen Glashütten. Pottasche (Kaliumcarbonat K2CO3) wurde dem Gemenge als Flussmittel zugesetzt, um den Schmelzpunkt von 1.800 °C auf 1.200 °C zu erniedrigen. Dabei wurden auf Haufen oder in Gruben Äste und Hölzer, bevorzugt von Laubbäumen, die einen höheren Ertrag an Pottasche lieferten als Nadelbäume, verbrannt, und die Asche später in Laugenfässern und Schlämmbottichen ausgelaugt, letztendlich gesotten und eingedampft und in Flammöfen kalziniert.
So erhielt man aus 1.000 kg Holz bei der Fichte 450 g, bei der Pappel 750 g, bei der Buche 1.450 g und bei Ulme und Esche 3.900 g Pottasche. Die Pottaschegewinnung führte gerade in den Bereichen rund um die Glashütten, zum Beispiel im Tettauer Winkel, bereits im 18. Jahrhundert zu einem Rückgang der Buche. Erst mit der Entdeckung der Kalisalzlagerstätten ab 1852 verlor die Pottaschegewinnung aus Waldholz an Bedeutung und die Wälder konnten sich wieder erholen. Namen von Waldabteilungen wie Kohlleite, Kohlholz oder Kohlstatt erinnern bis heute an die Nutzung des Waldes durch die Köhlerei. Im Rahmen der Kartierung von Kulturgütern im Frankenwald konnten Hunderte alter Meilerstätten in den Wäldern kartiert werden (Hagemann 2012).
Pottasche für die Glashütten
So erhielt man aus 1.000 kg Holz bei der Fichte 450 g, bei der Pappel 750 g, bei der Buche 1.450 g und bei Ulme und Esche 3.900 g Pottasche. Die Pottaschegewinnung führte gerade in den Bereichen rund um die Glashütten, zum Beispiel im Tettauer Winkel, bereits im 18. Jahrhundert zu einem Rückgang der Buche. Erst mit der Entdeckung der Kalisalzlagerstätten ab 1852 verlor die Pottaschegewinnung aus Waldholz an Bedeutung und die Wälder konnten sich wieder erholen.
Rückgang der Tanne...
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb.3: Die Tanne war ein stetiger Begleiter der Buche. Mitte des 19.Jahrhunderts begann ihr Rückzug aus dem Frankenwald. (Foto: M. Mößnang)
Die Tanne sollte also weiter die Hauptbaumart des Frankenwaldes bleiben und in einem 144-jährigen Umtrieb bewirtschaftet werden. Dennoch führten große Sturmwürfe zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Kahlschlagwirtschaft, Begründung von Reinbeständen und örtlich auch eine zunehmende Immissionsbelastung durch Glashütten und Papierfabriken vor allem ab 1900 zu einem merklichen Rückgang der Tanne und zur Ausbreitung der Fichte.
...und Siegeszug der Fichte
Auf vielen Flächen musste die Tanne nun im Gleichschluss mit der robusten Fichte aufwachsen, so dass sie dieser letztendlich unterlag. Die Fichte hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits diesen Zweikampf für sich entschieden. Im Jahre 1910 betrug die Baumartenverteilung im Frankenwald zwei Drittel Fichte, ein Drittel Tanne und nur noch sehr wenig Buche. Immerhin war 1934 das damalige Forstamt Kronach nach den forststatistischen Jahresberichten der Bayerischen Staatsforstverwaltung mit einem Anteil von 55 % Tanne noch das tannenreichste Forstamt ganz Bayerns.
Für den Staatswald im Frankenwald ergab sich 1934 noch eine Baumartenzusammensetzung aus 71 % Fichte, 25 % Tanne und 4 % andere Baumarten, vor allem Buche (Schmidt 2004). Nach den neuesten Erhebungen der letzten Bundeswaldinventur 2012 ist die Fichte weiterhin mit 72 % die wichtigste Baumart, gefolgt von der Buche mit 12 %, während die Tanne nur noch knapp zwei Prozent einnimmt.
Waldbau und Klimawandel
Mehrere Hauptbaumarten machen den Wald gemischter und durch naturnahe Forstwirtschaft und langfristige Verjüngungsvorgänge wird der Wald strukturreicher und vielfältiger. Aus ökologischen Gründen wird auch ein ausreichender Anteil der sogenannten Weichlaubhözer (Aspe, Birke, Salweide, Vogelbeere) belassen. Aus der Sicht des Försters und Waldbesitzers wird der Wald daher stabiler und krisensicherer und ist damit auch künftig weiterhin wertorientiert; aus der Sicht des Naturfreundes und Naturschützers wird der Wald naturnäher, nischenreicher und erhält die waldtypische Artenvielfalt; aus der Sicht des Waldbesuchers wird der Waldaufbau vielfältiger, interessanter und damit der Erlebniswert des Waldes höher.
Sensationeller Käferfund im Frankenwald
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb.4: Männlicher Mulmbock aus dem nördlichen Frankenwald (Foto: M. Schwarzmeier, AELF Kulmbach)
Der Mulmbock gehört mit einer Körperlänge von bis zu 60 mm zu den größten und eindrucksvollsten Bockkäfern unserer Heimat. Nach der Roten Liste der Bockkäfer Bayerns zählt er zu den vom Aussterben bedrohten Arten. In den letzten Jahrzehnten gibt es nur wenige Nachweise. Der einzige aktuellere Fund stammt aus dem Jahr 1973 vom Örtelberg bei Forchheim. Der Mulmbock bevorzugt zu seiner Entwicklung alte Kiefernstöcke in besonnter Lage. Die Entwicklung der Larven dauert mindestens drei Jahre. Die Käfer sind dämmerungs- und nachtaktiv und treten von Juli bis September auf.
Die Wälder des Frankenwalds werden durch die Fichte bestimmt. Kiefern treten nur nördlich des Rennsteiges auf. Das bestandsbildende Vorkommen der Kiefer in diesem Bereich ist auf zwei Gründe zurückzuführen: So liegen erstens die Wälder nördlich des Rennsteiges im Regenschatten und erhalten etwa 200 mm weniger Niederschlag, im Winter auch weniger Schnee. Daher ist die Schneebruchgefahr bei der Kiefer geringer als südlich des Rennsteiges. So konnte die Kiefer aus Thüringen in den Frankenwald vordringen.
Zum zweiten wurden die Wälder im nördlichen Frankenwald bereits seit dem 13. Jahrhundert sehr intensiv für die Verhüttung von Kupfererz genutzt. Es wurde in raubbauartiger Weise Holzkohle gewonnen, die örtlich zu einer Devastierung der Wälder führte. Von dieser Übernutzung hat die Kiefer als Rohbodenbesiedler und Pionierbaumart in den früheren Jahrhunderten profitiert und konnte sich dann bestandsbildend ausbreiten. Der sensationelle Fund des seltenen Mulmbocks lässt aber die Bedeutung der Kiefer als Mischbaumart auch im Frankenwald im neuen Licht erscheinen.
Olaf Schmidt und Melanie Schwarzmeier
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Links
- Baumkrankheiten auf der Spur - LWF aktuell 112
- Frankenwald - Waldgebeit des Jahres

- Prachtkäfer profitieren vom Trockensommer 2015 - LWF aktuell 112
- Newsletter - Service der LWF
- LWF aktuell - Übersicht