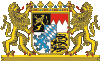Gerd Lupp, Herbert Rudolf, Valerie Kantelberg, Marc Koch, Günter Weber und Stephan Pauleit
Welcher Wald ist schön? - LWF-aktuell 111
Ist die Schönheit von Wald und Landschaft ein rein subjektives Empfinden oder gibt es Aussagen, die man verallgemeinern kann? Dem Menschen scheinen tatsächlich bestimmte Neigungen angeboren zu sein, was als »schön« wahrgenommen wird. Jedoch können Prägungen, Wissen, Gruppennormen, aber auch individuelle Erfahrungen das Empfinden beim Betrachtenden verändern. Waldästhetik ist ein Beispiel dafür, dass Wissen und normative Festsetzungen dazu beitragen, den Wald als »schön« zu empfinden. Was bedeutet das für die Waldbewirtschaftung?
Vielfalt, Eigenart und Schönheit werden als wesentliche Voraussetzungen für die Erholungseignung von Wäldern genannt. Nach Nohl (2001) spielen aber auch die aktuelle Befindlichkeit, Erfahrungen, Wissen und Wertehaltungen, Erwartungen sowie Erinnerungen eine Rolle. Menschen nehmen Wälder daher selektiv wahr. Einzelne Teile werden in ihrer Bedeutung akzentuiert, zusätzlich spielen auch situationsbedingte Einflüsse wie Jahreszeit, Wetter, der Betrachtungspunkt, die Aktivität, die Fortbewegungsart, die Stimmung und eigene Gefühle sowie alleiniges oder kollektives Erleben der Landschaft eine Rolle.
Dies bedeutet, dass der gleiche Wald von jeder Person anders wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Auch ein und dieselbe Person kann das gleiche Waldbild in verschiedenen Lebensabschnitten anders bewerten, zum Beispiel als Kind anders als im Erwachsenenalter.
Etwas Theorie zur Landschaftsund Waldästhetik
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 1: Laubmischwälder empfinden die meisten Waldbesucher vor allem im Herbst als besonders schön. (Foto: G. Lupp)
Demnach bevorzugen Menschen Landschaften, die für das Überleben bis in die moderne Zeit von essenzieller Bedeutung waren. Als besonders attraktiv würden demnach Landschaften empfunden, die Ausblicke, Deckung für Jagdmöglichkeiten, Schutz und Unterschlupf vor Feinden sowie ausreichend Wasser bieten. Somit würden Menschen parkartige Landschaften (vgl. Abbildung 2) mit vereinzelten Baumgruppen, freien Grasflächen, Gewässern, natürlichen Ausblicken und Deckungsmöglichkeiten besonders präferieren (Bürger-Arndt und Reeh 2006). Diese werden als »Prospect-and- Refuge-Theory« von Appleton (1975), die »Savannah-Theory« von Orians (1980) oder die »Information-Process-Theory« von Kaplan und Kaplan (1989) bezeichnet.
In einer zweiten Ebene werden Präferenzen durch soziale Regeln und Normen wie Lernen, Reflektieren, Erfahrung und evolutionäre Erkenntnis gebildet (Bourassa 1991). Die aufgestellten Werte und Normen für »Schönheit« besitzen dabei meist keine universelle Gültigkeit, sie können beispielsweise auch nur von einzelnen Gruppen, einer Gesellschaft oder nur einem Kulturkreis akzeptiert werden und dienen als Abgrenzung gegenüber anderen.
weiterlesen
Wichtig bei allen Analysen ist, dass neben visuellen Eindrücken auch alle anderen Sinneseindrücke berücksichtigt werden müssen, also auch das Hören, Fühlen und Riechen. Die Landschaft in Abbildung 2 mag einen nahezu idealen Landschaftseindruck im Sinne der genetisch fixierten Präferenzen sein.
Im Rücken des Fotografen befand sich aber eine große Tankstelle an einer stark befahrenen vierspurigen Straße. Der positive optische Sinneseindruck wird vom Verkehrslärm, Abgasen und Benzingeruch beeinträchtigt.
Nach der »Wahrnehmung« gefragt
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 2: Parkartige Landschaft mit Gewässern (Foto: G. Lupp)
Bei Befragungen auf Wochenmärkten und im Internet wünschte sich eine deutliche Mehrheit der Befragten auch in direkter Stadtnähe möglichst ursprüngliche Waldbilder, die unberührt wirken und die einen Kontrast zum urbanen Umfeld vermitteln sollen (Krimbacher und Kühnhäuser 2014, zit. in Lupp et al. 2016).
Ein »gepflegter Wald« wird von der Mehrheit abgelehnt, vielmehr wünscht man sich »Wildnis«. »Wildnis« ist dabei jedoch nicht im Sinne von Prozessschutz zu verstehen, sondern wird bei genauerem Nachfragen vielfach im Sinne eines Rückzugsraums vom städtischen Alltag und größeren Menschenansammlungen und ökonomischen Zwängen verstanden, in dem spontane und überraschende Begegnungen mit der Natur möglich sein sollen (Lupp et al. 2011).
Bei derartigen Fragestellungen ist jedoch zu beachten, dass dabei jede/jeder Befragte gedanklich einen Wald vor Augen hat, über den geurteilt wird, der für den Fragesteller nur sehr bedingt fassbar wird.
Direkt vor Ort
Bei den Begründungen lässt sich hingegen zeigen, dass bei den weniger attraktiven Waldtypen das Waldbild im Vergleich zu sehr attraktiven Eindrücken für die gute Benotung in den Hintergrund tritt. Als Begründung für gute Noten werden neben der Vertrautheit derartiger Waldbilder auch allgemeine Aussagen wie »gut, weil ich heute in der Natur unterwegs sein kann« oder »Radfahren in diesem Wald macht mir Freude« genannt. Daher werden auch ästhetisch weniger attraktive Wälder gerne als Erholungsgebiet angenommen.
Bilder sagen mehr als Worte
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 3: Beispiel für besonders präferierte Waldbilder
(Foto: G. Lupp)
Im Projekt »Stadtwald 2050« wurden dabei gezielt der derzeit forcierte Waldumbau und die damit verbundenen bzw. entstehenden Waldbilder abgefragt. Dabei wurde auch mit für den Großraum München typischen Wald-Bildsätzen gearbeitet, die unterschiedliche Stadien des Waldumbaus enthielten (Hirschbeck und Ritter 2014; Braun 2015; Seidel und Raab 2015). Die Fotos bzw. Abbildungen sollten dabei einem erzwungenen Ranking unterzogen werden.
Das Vorgehen bei dieser Befragung entspricht dem bei Stephenson (1953) beschriebenen Q-Sort-Verfahren. Aus einem Bildsatz mit 16 Bildern werden jeweils vier Bilder ausgewählt, die gut bzw. die weniger gefallen. Aus dieser Vorauswahl wird bei den positiven Bildern das attraktivste ausgewählt, bei den negativen Eindrücken dasjenige, das am wenigsten gefällt. Für das beste bzw. schlechteste Bild wurde jeweils um eine kurze Begründung gebeten, weshalb dieses ausgewählt wurde.
Platz eins für gestuft, gemischt und strukturiert
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 4: Dauerwaldartige
Strukturen mit gestaffelter
Raumtiefe (Foto: H. Rudolf)
Diese werden, auch wenn derartige Bestände ein Produkt der Forstwirtschaft und auf Strategien wie Waldumbau bzw. Bewirtschaftungsformen wie Femeln oder Plentern zurückzuführen sind, als besonders naturnah oder »wild« angesprochen. Die Befragten argumentieren bei der Begründung, weshalb das Bild dieses Waldbestands ausgewählt wurde, oft mit tatsächlich vorhandenem oder vermeintlichem ökologischem Wissen.
Typische Antworten sind beispielsweise, dass derartige Waldbilder »auch gut für die Artenvielfalt « sind oder dass Totholz »Lebensraum für Tiere und Vögel« bietet. Am unteren Ende des Ranking stehen dichte, einschichtige Fichtenbestände. Aber auch die weniger attraktiven Waldbilder sind nicht grundsätzlich schlecht, die Befragten äußern, sich vielmehr dem Zwang zu beugen, ein negatives Bild aussuchen zu müssen.
Bei diesen negativen wird hier auffällig häufig »die Forstwirtschaft« und »Streben nach Profit« ausgemacht, die mit den Waldbildern assoziiert werden. Interessanterweise wurden Eindrücke der Kiefernbestände bei Befragungen im Norden von München sehr gut bewertet. Diese stellen den vertrauten Wald vor der Haustüre dar und werden als sehr positive Elemente des persönlichen Wohnumfelds wahrgenommen. Auch gilt es, jahreszeitliche Aspekte zu berücksichtigen. Im Winter und mit Schneebedeckung wurden in den Bildsätzen nadelholzreiche Bestände höher bewertet als in anderen Jahreszeiten.
Mit der Kamera den Wald bewerten
Am Ende des Spaziergangs sollten die Probanden jeweils drei Bilder auswählen, auf denen besonders positive Eindrücke abgebildet wurden, sowie drei Abbildungen mit Dingen, die als besonders negativ empfunden wurden, und diese Auswahl begründen. Fast allen Probanden missfielen auch kleine Hinterlassenschaften wie weggeworfene Papiertaschentücher, ebenso wurden Zeichen der Forstwirtschaft wie abgesägte Baumstümpfe und tiefe Fahrspuren auf Rückegassen nicht geschätzt. Auch wurden Bäume, die vermeintlich krank aussahen, als negativ empfunden. Dabei handelte es sich aber in einigen Fällen um Bäume, die aufgrund des sehr heißen und trockenen Sommers 2015 bereits vorzeitig das Laub abwarfen.
Als besonders positiv wurden gemischte Waldstrukturen, markante Einzelbäume am Weg, das Spiel von Farbe, Licht und Schatten im Wald sowie gewundene schmale Wege und die Öffnung des Waldes zu einer Lichtung als besonders attraktiv angesehen.
Eng verzahnt: jung & alt, groß & klein, vital & zerfallend
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 5: Hauptstrukturbaum (Foto: H. Rudolf)
Auch wenn die Präferenzen bei Befragungen eine gewisse Streuung aufweisen, so liegt es nahe, auf Waldbaustrategien zu setzen, die auf strukturreiche Mischbestände sowie integrativen Waldnaturschutz abzielen. Sie bringen Waldbilder hervor, die die Bevölkerung besonders wertschätzt (Abbildung 4). Das Nebeneinander von Alt und Jung, Groß und Klein erzeugt Spannung und liegt assoziativ nahe beim Bild des Familiären. Mächtige, großkronige Bäume spielen dabei eine tragende Rolle.
Naturverjüngung wird mit Natürlichkeit und Vitalität, Totholz und all mählich absterbende »Veteranen« (Biotopbäume) mit »Wildnis« in Verbindung gebracht. Zu bedenken ist jedoch, dass bei derartig bewirtschafteten Wäldern häufig der Tiefeneindruck verloren geht, der für uns Menschen gemäß Theorien der genetisch fixierten Präferenzen für halboffene Landschaften wichtig ist. Deshalb ist darauf zu achten, dass in stufige, plenterartige Wälder mit reichlichem Nachwuchs immer wieder auch transparente, hallenartige Kleinbestände eingebettet sind, die es ermöglichen, einen weiteren Blick für den Betrachter zu erzielen.
weiterlesen
Breite Weg- oder Leitungstrassen bzw. Saum- oder Räumungshiebe sollten hingegen vermieden werden. Diese erzeugen meist gestörte Ränder, gegebenenfalls sogar unschöne Einblicke in hinterliegende weniger attraktive Waldbestände. Die meisten Waldaußenränder sind überdicht. Dadurch betonen sie, wie schroffe Wände, die Grenzlinien zu den benachbarten Landnutzungsarten.
Zur Entwicklung lockerer, strauch- und blütenreicher Übergänge erscheinen die Empfehlungen von Gockel (2012) vielversprechend. Unter dem Arbeitstitel »Mittelwaldähnliche Waldrandgestaltung« könnten damit Elemente einer historischen Nutzungsform, die naturschutzfachlich wie ästhetisch sehr interessant sind, in die oben beschriebenen Waldbaustrategien zwanglos eingegliedert werden. Daneben können weitere gestalterische Maßnahmen angewendet werden.
»Requisiten der Inszenierung«
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abbildung 6: Eine markante Buche am Wegesrand (Foto: G. Lupp)
Exemplare, die sich durch gezielte Freistellung in der Krone zu solitären »Baumpersönlichkeiten « entwickelt haben, machen die Wege, an denen sie stehen, zu besonderen Spazierwegen und ihre Standorte häufig zu Lieblingsplätzen im Wald. Mössmer (2012) nennt diese treffend »Hauptstrukturbäume «. Ein ähnliches Augenmerk wie besonders geformte oder seltene Bäume verdienen auch Spuren der Geschichte im Wald wie Wegkreuze, alte Grenzzeichen, Burgställe oder historische Kleinarchitekturen. Sie ermöglichen dem interessierten Waldbesucher, in die Geschichtlichkeit des Ortes einzutauchen.
Bei der Waldwahrnehmung gilt es jedoch, nicht nur auf die Qualität von Waldbildern zu achten. Selbst wenn diese als schön empfunden werden, kippt diese positive Stimmung häufig ins Negative, sobald industriell anmutende Formen der Holzbereitstellung auf den Plan treten. Moderne Ernteverfahren sollten an Erholungsschwerpunkten daher so organisiert werden, dass sie möglichst wenig auffallen.
weiterlesen
Schon durch gelegentliche Abweichungen vom gestreckten Verlauf gelingt es, die Einsehbarkeit deutlich herabzusetzen. Eine zügige Holzabfuhr bei guter Benutzbarkeit der Waldwege ist ebenfalls Bestandteil, die als störend empfundenen Spuren der Holzernte zu verwischen.
Um für Waldbesucher Identität stiftende Waldbestandteile zu identifizieren und besser berücksichtigen zu können, sollten die örtlichen Bewirtschafter versuchen, »ihre« Waldbesucher möglichst gut kennenzulernen. Sie sollten sich dafür Zeit nehmen, um mit den Waldbesuchern ins Gespräch zu kommen und über die geplanten Maßnahmen und deren Sinn und Zweck informieren, am Besten im persönlichen Gespräch.
Zusammenfassung
Jedoch werden diese durch Prägung, gesellschaftliche Normen, Lernen und persönliche Erfahrungen verändert. Bevorzugte Waldbilder sind strukturierte, stufig aufgebaute Mischbestände, die auch ein wenig Totholz enthalten dürfen und die als besonders naturnah angesprochen werden. Deutlich wird bei den Begründungen eine normative Werthaltung.
Dennoch werden auch andere Waldtypen gerne zur Erholung angenommen. Mit Einfühlungsvermögen und einem Austausch mit Waldbesuchern kann bei der Waldpflege mit einfachen Mitteln gezielt die ästhetische Qualität verbessert werden.
Hintergrund
Was ist »Wildnis«?
»Wildnis« ist nach Wikipedia kein naturwissenschaftlicher, sondern ein alltagssprachlicher Begriff mit unterschiedlichen, kulturell geprägten Bedeutungen. Im Gegensatz zu den USA mit dem »Wilderness Act« gibt es bei uns auch keine physische Definition. Es ist schwierig, über den Beeinflussungsgrad des Menschen eine klare Linie zu definieren, ab wann und ab welcher Mindestgröße ein Naturraum möglicherweise »Wildnis« sein kann und wann nicht.
Befragt man Laien, was diese unter »Wildnis« verstehen, werden vielfach sehr emotionale Werturteile und Eigenschaften genannt, die einem realen oder imaginären Stück Natur zugesprochen werden und mehrheitlich mit positiven Assoziationen verbunden sind. Die Spanne der Beschreibungen reicht von einem »verwilderten« Hinterhof in der Großstadt bis zur Aussage, dass man »Wildnis nicht einmal mehr in der Antarktis finden kann, da überall Spuren des Menschen zu finden sind«.
»Wildnis« wird von Laien vielfach als Gegenwelt zum Alltag mit seinen Zwängen angesehen. Sie ist mit spontanen, überraschenden Naturerlebnissen verbunden. Man begegnet dort nur wenigen Menschen, verspürt Einsamkeit und es ist für die Befragten mit Aufwand verbunden, dorthin zu gelangen.
In stadtnahen Wäldern können z. B. dichte Auwälder, aber auch abseits der Hauptbesuchsströme gelegene strukturierte Waldbestände »eine kleine Wildnis vor der Haustüre« vermitteln, auch wenn diese Wälder in der Realität das Ergebnis regelmäßiger Managementmaßnahmen sind. »Wildnis« ist damit nicht mit Prozessschutz gleichzusetzen. In der Kommunikation sollte daher dieser vieldeutige Begriff sehr vorsichtig verwendet werden.
Mehr
Beitrag zum Ausdrucken
Weiterführende Links
Autoren
- Dr. Gerd Lupp, TU München
- Herbert Rudolf, BaySF - Forstbetrieb Freising
- Valerie Kantelberg
- Marc Koch
- Günter Weber, TU München
- Prof. Dr. Stephan Pauleit, TU München