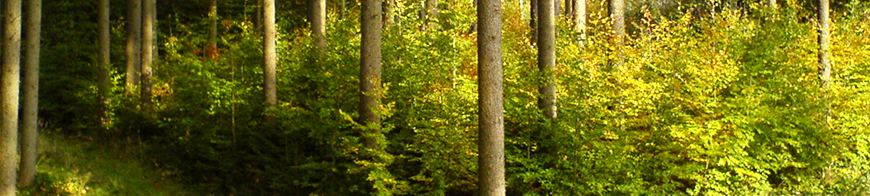LWF wissen 88
Die Mehlbeere im bayerischen Staatswald
von Alexander Rumpel, Sabrina Thoma, Michael Hollersbacher, Alexander Schnell und Sebastian Höllerl
Selten, aber dennoch besonders. Die Echte Mehlbeere (Sorbus aria) hat für den Waldnaturschutz und strukturreiche (Berg-)Wälder eine wichtige Bedeutung. Eine Besonderheit ist die große Vielfalt an Mehlbeeren-Arten, die in den unterschiedlichen Naturräumen Bayerns als Regional- und Lokalendemiten vorkommen. Aufgrund ihrer Lichtbedürftigkeit und ihres vergleichsweise langsamen Wachstums finden wir die Mehlbeere derzeit überwiegend als Begleitbaumart an Waldrändern. Auch in Berg- und damit auch Schutzwäldern kommt sie häufiger vor. Durch ihre hohe Standortamplitude, Trockentoleranz und Hitzeverträglichkeit wird die Rolle der Mehlbeere in Zeiten des Klimawandels zunehmend wichtiger. Im Rahmen der Waldbaugrundsätze der BaySF werden seltene heimische Baumarten besonders gefördert und erhalten. Durch Nachzucht im eigenen Pflanzgarten sowie gezielte Pflanzung leisten die Bayerischen Staatsforsten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der vielfältigen Mehlbeerarten.
Vorkommen der Mehlbeere im bayerischen Staatswald
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 1: Verteilung der Mehlbeeren (Untergattung Aria) auf Flächen der BaySF in Oberschicht (grün), Voraus-verjüngung (orange) und Unter- und Zwischenstand (violett).
(© A. Schnell, BaySF)
Die sehr seltene, aber ökologisch wertvolle Mischbaumart Mehlbeere kommt bei den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) in überschaubarem Umfang vor.
Im Zuge der BaySF-Waldinventur wird Sorbus aria als weit gefasste Baumart behandelt. Eine Unterscheidung zwischen der Echten Mehlbeere im engeren Sinne (Sorbus aria s. str.) und anderen, mit ihr nahe verwandten und morphologisch ähnlichen Mehlbeer-Kleinarten und Hybriden, wie beispielsweise der Donau-Mehlbeere (Sorbus danubialis), wird aufgrund des komplexen genetischen und taxonomischen Status und der teilweise sehr ähnlichen äußeren Merkmale aus praktischen Gründen nicht vorgenommen.
Über 90 % aller von der Inventur aufgenommenen Mehlbeeren auf Flächen der BaySF finden sich in den fünf Hochgebirgsforstbetrieben Bad Tölz, Berchtesgaden, Oberammergau, Ruhpolding und Schliersee. Kleinere Vorkommen der Mehlbeere liegen im Fünf-Seen-Land, auf der südlichen Frankenalb, in der Rhön, auf der Fränkischen Platte, im Oberpfälzer Jura und im Nordwesten des fränkischen Triashügellandes. (Abbildung 1).
Nach Inventurpunktauswertungen beträgt die Netto-Fläche der Mehlbeeren in der Oberschicht insgesamt 281 Hektar, davon 244 Hektar in den Hochgebirgsforstbetrieben (Hochgebirge). Im Unter- und Zwischenstand umfasst ihre Nettofläche 897 Hektar (795 Hektar im Hochgebirge). In der Vorausverjüngung (bis 5 m) stocken etwa 1075 ha Mehlbeere (davon 1009 Hektar im Hochgebirge).
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 2: Darstellung der Fläche in ha in Abhängigkeit der Altersklassen mit je 20 Jahren (I – IX) für die Mehlbeere. (© LWF)
Das größte Verbreitungsgebiet unter den Mehlbeeren hat die Echte Mehlbeere (Sorbus aria s. str.), welche auch noch in den wärmebegünstigten Bergwaldlagen der Bayerischen Alpen wächst. Sie wird bis zu 15 m, im Ausnahmefall bis 20 m hoch. Dagegen erreicht die Pannonische Mehlbeere (Sorbus pannonica) lediglich Höhen von ca. 10 m und ist in ihrem Vorkommen größtenteils auf meist felsige Bereiche des Bayerischen Juras reduziert. Die Donau-Mehlbeere (Sorbus danubialis) bleibt mit 4 m Höhe dagegen nur ein Strauch und kommt ausschließlich auf Sonderstandorten in den südöstlichen Lagen des Bayerischen Juras vor. Die Breitblättrigen Mehlbeeren (z. B. Regensburger Mehlbeere, Eichstätter Mehlbeere) sind ausgesprochene Raritäten mit oftmals erstaunlichen Wuchsformen, die als Endemiten meist auf Sonderstandorten in sehr kleinen, eingegrenzten Arealen des Bayerischen Juras und der Fränkischen Platte wachsen.
Abbildung 2 zeigt deutlich, dass das Hauptvorkommen der Mehlbeeren mit rund 143 Hektar bzw. 50 % im Wesentlichen in der ersten Altersklasse liegt (1 bis 19 Jahre alt). Ein Großteil davon rührt aus Naturverjüngung. In den letzten 10 Jahren wurden bei den BaySF aber auch rund 4 Hektar an Neukulturen mit Mehlbeere angelegt.
Bedeutung der Mehlbeere bei den Bayerischen Staatsforsten
Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Bedeutung
Die Bayerischen Staatsforsten tragen auf rund 11 % der Landesflächen Bayerns eine besondere Verantwortung für den Erhalt naturnaher Waldlebensräume und waldassoziierten Artengemeinschaften. Dazu zählen – neben vielen wertvollen Offenlandflächen – auch licht bestockte Bereiche sowie Waldränder (Ökotone), die entweder als Sonderstandorte besonderen Schutz genießen oder als Trittsteine mit besonderem Management für die biologische Vielfalt zielgerichtet erhalten bzw. gepflegt werden (BaySF 2023).
Obwohl die Echte Mehlbeere (S. aria s. str.) in Deutschland als ungefährdet gilt (Rote Liste Deutschland, 2018; Rote Liste Bayern), ist sie von hoher naturschutzfachlicher und landschaftsökologischer Bedeutung. Das liegt einerseits an der Funktion als wichtige Nahrungsquelle für verschiedenste Tierartengruppen, ihrer Bindung an bestimmte Pflanzengesellschaften mit wichtiger Lebensraumfunktion für seltenen gewordenen Artengemeinschaften sowie an ihrer Eignung als stresstoleranter Zukunftsbaum, gerade im siedlungsnahen Wald- und Parkbereichen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 3: Lichter, buschartiger Eichentrockenwald im Naabtal: Ein Paradebeispiel für einen sehr seltenen Waldlebensraum mit für mitteleuropäische Verhältnisse üppiger Artenausstattung. (© A. Rumpel)
Die mehligen, orangeroten Früchte der Mehlbeere werden, ähnlich wie die Früchte der Vogelbeere, von zahlreichen Vogelarten genutzt. Dazu zählen u. a. verschiedene Drossel- und Grasmückenarten sowie in höheren Lagen, insbesondere im Alpenraum auch Vertreter aus der Gruppe der Raufußhühner. Zugute kommt den Vogelarten dabei die frühe Fruktifikationsfähigkeit der Mehlbeere, die große Fruchtanzahl sowie die Eigenschaft, die Früchte bis lange in den Winter zu halten (Schmidt 2024). Darüber hinaus bietet die Mehlbeere ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Insekten im Gegenzug zu deren Bestäubungsleistungen. Zu den wichtigsten Bestäubergruppen zählen dabei Bienen, Falter sowie zahlreiche Schwebfliegenarten (floraweb.de 2024).
Neben ihrer Funktion als Nahrungsquelle eignet sich die Mehlbeere – hier insbesondere auch die zahlreichen regionalen Kleinarten – als naturschutzfachliche Zielart, anhand deren Vorkommen Pflege und Erhaltungsmaßnahmen räumlich und inhaltlich effektiv ausgerichtet werden können. Die Vorkommen der Mehlbeere konzentrieren sich auf trockene bis mäßig frische, lichte Laubmischwälder und Gebüsche wärmebegünstigter Standorte im Hügel- und Berglagen. Dazu zählen neben lückigen Buchenbeständen in Hang- und Trockenlagen Eichen-Trockenwälder, trockenwarme Gebüschformationen sowie Steinriegeln an Felsen und in Heiden (Roloff 2024). Diese Lebensräume sind aufgrund ihrer Wärmegunst, der hohen Struktur- und Gehölzvielfalt sowie extensiver Nutzungsformen ein im Landschaftsbild selten gewordener Lebensraum im Übergang vom Offenland zum geschlossenen Wald (Abbildung 3).
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 4: Gezielt für das lokale Vorkommen der Eichstätter Mehlbeere (Sorbus eystettensis) licht gestellter Altbestand auf Flächen des Forstbetriebs Kipfenberg. (© A. Rumpel)
Insbesondere in den Vorkommensbereichen der Mehlbeere außerhalb der Alpen finden spezialisierte und gefährdete Artengemeinschaften zuträgliche Habitatbedingungen. Dazu zählen konkurrenzschwache Kleingehölze wie Wildrosen und andere Wildobstarten, Staudengewächse wie Schwalbenwurz und Diptam („Brennender Busch") sowie zahlreiche weitere floristische und faunistische Elemente mit schwerpunktmäßig submediterraner Verbreitung. Sofern es sich nicht um primäre, also weitgehend selbsterhaltende Vorkommen an der edaphischen Trockengrenze des Waldes im Traufbereich von Felswänden und Felsterrassen mit hoher Strahlungsenergie handelt, bedürfen diese Sonderlebensräume gelegentlicher Pflegemaßnahmen. Dazu zählen Waldrandstrukturpflege, nieder- bzw. mittelwaldartige Erhaltungsmaßnahmen oder die Beweidung mit Ziegen und Schafen.
Gezielte Maßnahmen zugunsten von Mehlbeeren und deren Lebensräumen werden u. a. an den Forstbetrieben Forchheim, Kipfenberg und Burglengenfeld durchgeführt. Dabei sind folgende naturschutzfachlichen Zielsetzungen von besonderer Bedeutung:
- Erhalt der seltenen, autochthonen Gehölzarten innerhalb der laubholzreichen Wälder. Insbesondere werden Elsbeere (Sorbus torminalis), div. Mehlbeerarten (Sorbus Untergattung Aria), Speierling (Sorbus domestica), Wildbirne (Pyrus pyraster) und Eibe (Taxus baccata) erhalten und gefördert.
- Förderung und Erhalt von seltenen, autochthonen Straucharten an Waldinnen- und -außenrändern. Insbesondere handelt es sich um div. Wildrosenarten (Rosa spec.), Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Felsenkirsche (Prunus mahaleb), Felsen-Zwergmispel (Cotoneastser integerrimus), und Kreuzdorn (Rhamnus cathartica).
- Die Pflegemaßnahmen zugunsten der genannten Arten sollen dabei grundsätzlich zwei Ziele verfolgen: die Stabilisierung des jeweiligen Vorkommens sowie die Förderung fruchtifizierender Exemplare.
Die seltenen Baum- und Straucharten werden durch Pflege- und /oder Schutzmaßnahmen gefördert. Die Förderung umfasst neben der Standraumerweiterung und Kronenpflege zur Vitalitätssteigerung auch den evtl. Erhalt und die Kontrolle von bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen. Durch die Kronenpflege soll auch die Fruktifikation von älteren Individuen angeregt und gefördert werden (Abbildung 4 und 5). Daneben werden die oben genannten Arten auch gezielt im Rahmen von Waldrandstrukturpflegemaßnahmen gefördert bzw. erhalten (Huschik 2013).
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Abb. 5: Freigestellter Dolomit-Felsenbereich; neben licht-bedürftigen Rote-Liste-Arten profitiert auch die Donau-Mehlbeere von den behut-samen Freistellungen.
(© P. Bohn)
Darüber hinaus eignet sich die Pionierbaumart Mehlbeere u. a. aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Stresstoleranz gegenüber intensiver Sonnenstrahlung und sonstigen Stressfaktoren (u. a. Feinstaubbindung), des attraktiven Erscheinungsbildes und ihrer hohen Eignung als Trachtbaum für Imker sehr gut als heimischer Zukunftsbaum, gerade auch in stadtnahen Wald- und Parkgebieten. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels erhalten der Schutz und gegebenenfalls auch die Wiedereinbringung seltener, wärmetoleranter Gehölzarten noch höhere Bedeutung. Dazu gehören aus der Gattung Sorbus aus forstwirtschaftlicher Sicht in erster Linie die konkurrenz- bzw. wuchskräftigeren Arten Elsbeere (Sorbus torminalis) und Speierling (Sorbus domestica), aber fallweise auch, wie beispielsweise bei der Wiederbestockung von Lawinenbahnen oder Schadflächen, der Pflege strukturreicher Waldränder sowie im Kontext neuer Herausforderungen der „Urban Forestry", auch die Mehlbeere mit ihrer hohen Formenvielfalt.
Zur weiteren Vermittlung von Wissen zur Förderung und Verbreitung seltener Gehölzarten bietet die BaySF jährlich eine Fortbildungsveranstaltung in Kooperation mit dem Amt für Waldgenetik in Teisendorf und dem Pflanzgarten in Laufen an. Neben der Vermittlung von Kenntnissen zur Formenvielfalt, Verbreitung und Gefährdung heimischer Gehölzraritäten wie beispielsweise der Eichstätter Mehlbeere werden dort auch Aspekte wie die Nachzucht, der Anbau und die waldbauliche Behandlung von sonstigen seltenen Baumarten praxisnah vermittelt.
Die waldbauliche Bedeutung der Mehlbeere
Grundsätzlich scheiden die Mehlbeeren für eine forstliche Nutzung aus. Der Fokus liegt hier eindeutig im Artenschutz. Aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Bedeutung bedarf es im waldbaulichen Umgang mit diesen Arten entsprechendes Fingerspitzengefühl.
In den Wäldern wurden die Mehlbeeren bisher oftmals übersehen und vernachlässigt. Viele Individuen fristen daher ein kümmerliches Dasein mit eingezwängten Kronen, überwachsen und unterdrückt von den wüchsigeren Hauptbaumarten.
Solche Bäume sollten über vorsichtige Pflegemaßnahmen entsprechend begünstigt werden. Jedoch bedarf es hier eines sehr sorgsamen Vorgehens. Keinesfalls dürfen eingezwängte Bäume radikal freigestellt werden. In ihrer Kronenausformung unterdrückte Individuen benötigen ein behutsames Vorgehen, am besten über mehrere Jahre hinweg. Werden solche Bäume zu schnell radikal freigestellt, besteht eine große Gefahr des Absterbens.
Beim ersten Eingriff sollen daher möglichst maximal zwei deutliche Bedränger entfernt werden. Erst nach weiteren 3 – 5 Jahren können die nächsten bedrängenden Bäume entnommen werden. Sollte dann noch ein weiterer Förderungsbedarf bestehen, so werden erneut nach weiteren 3 – 5 Jahren konkurrierende Bäume entnommen. Auf diese Art und Weise können sich die Bäume über die Jahre wieder festigen und ihre Kronen entsprechend ausbauen.
Neben der Förderung über Pflegeeingriffe, sollten die Mehlbeerenarten auch gezielt nachgezogen und in Wäldern wieder ausgebracht werden. Sie eignen sich hervorragend zur Anreicherung von Außen- wie Innenwaldrändern. Da diese Arten sehr lichtbedürftig sind, sollen diese auch nur in sonnigen Bereichen ausgebracht werden. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, die Mehlbeeren nicht mit anderen (konkurrenzkräftigeren) Baumarten zu mischen. In Waldrandsituationen sollten sie nur in größeren Trupps (Radius mindestens 15 m) ausgebracht werden. Um Konkurrenzsituationen zu vermeiden, sollen benachbart nur niedrige Sträucher gepflanzt werden. Bei der Pflanzenbeschaffung muss berücksichtig werden, dass bei den Mehlbeeren nur gesichertes, regionales Herkunftsmaterial aus Spezialbaumschulen verwendet wird.
Literatur
- BaySF (Hrsg., 2023): Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten, Regensburg.
- Meyer, N.; Meierott, L.; Schuwerk, H. (2005): Beiträge zur Gattung Sorbus in Bayern. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, Sonderband, 216 S.
- Huschik, K. (2013): Biodiversität steigern – auch mit Wildobst im Bayerischen Staatswald, in: LWF Wissen 73, Freising.
- Schmidt, O. (2024): Die Mehlbeere und die Vogelwelt, in: Deutscher Waldbesitzer 1/20224.
- Roloff, A. (2024): Die Echte Mehlbeere – Baum des Jahres 2024, in: AFZ Der Wald 4/2024.
- Brandl, S.; Mette, T. (2021): ANALOG – Waldzukunft zum Anfassen. Klimawandel und Baumartenwahl: Beispiel Frankenwald. LWF Aktuell 3/2021, S. 42 - 45.
Weiterführende Informationen
Autor
- Alexander Rumpel
- Sabrina Thoma
- Michael Hollersbacher
- Alexander Schnell
- Sebastian Höllerl
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden